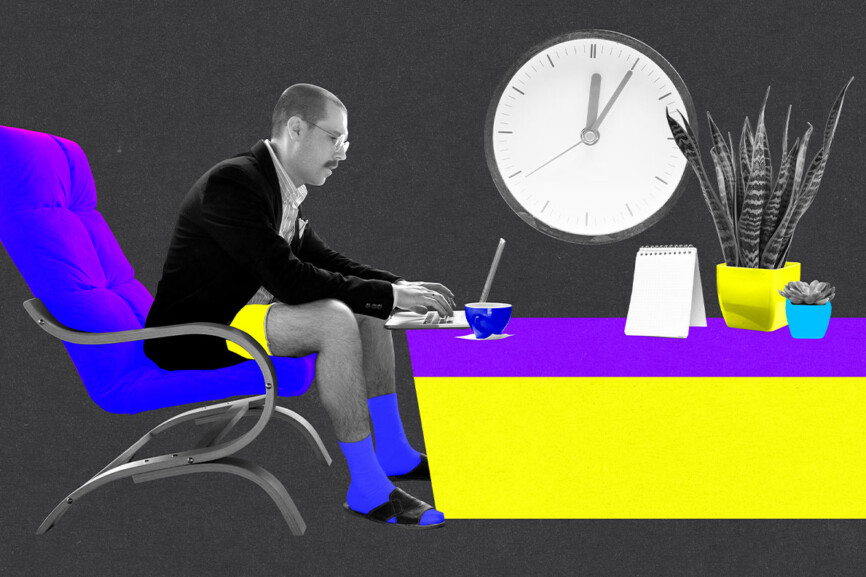Im Thema Homeoffice steckt gerade ganz schön Dampf. Zwar überrascht es mich nicht, dass meine jüngste Kolumne „Endlich sagt’s mal einer“ über die neue Präsenzpflicht bei Antoni für Reaktionen sorgte. Doch die Heftigkeit lässt nichts Gutes erahnen. Beim Thema Homeoffice geht offenbar immer mehr Leuten die Hutschnur hoch – Gegnern wie Befürwortern. Per LinkedIn, E-Mail und sogar telefonisch erreichten mich in den vergangenen Wochen ausgesprochen viele ziemlich emotionale Reaktionen.
Zwei davon möchte ich an dieser Stelle nochmal aufgreifen, weil sie meiner Ansicht nach am deutlichsten die zunehmende Polarisierung zeigen. Wobei ich es schade bis befremdlich finde, dass das Thema offenbar derart viel Reizstoff birgt, dass sich einige Menschen nur noch anonym zitieren lassen wollten.
Vor allem Gegner des Homeoffice fürchten, sich bei Kolleginnen und Kollegen unbeliebt zu machen. So schreibt mir eine Frau, die Head of Marketing & PR bei einer norddeutschen Agentur ist: „Ich habe kürzlich in der Agentur innerhalb eines Meetings mit allen Kolleginnen vorgeschlagen, von drei auf zwei Tage Homeoffice zurückzudrehen, um Dinge besser voranzutreiben und mehr erlebbares ,Wir-Gefühl‘ zu bekommen.“ Die Antwort sei „Kopfschütteln und totales Unverständnis“ gewesen. Am liebsten, so schreibt sie weiter, würde sie sich wegen der neuen Präsenzpflicht sofort bei Antoni bewerben. Seit Ende der Pandemie sieht die Frau „überall nur noch ziemliche Egotrips“. Manche Kolleg*innen würden über lange Anfahrtszeiten klagen, andere über Kinder, die aus der Kita abgeholt werden müssen. „Wie haben all die Leute ihr Leben vor Corona auf die Reihe bekommen?“, fragt sie sich.
Heftige Worte, die zeigen, dass es in manchen Unternehmen um Teamspirit und Kultur derzeit auch wegen der Homeoffice-Debatten nicht gerade zum Besten steht.
Karrierekiller Remote?
Das Minenfeld Homeoffice sorgt aber nicht nur organisatorisch für große Reibung. Die Begründung von Antoni-Kreativchef Matthias Schmidt, dass Führung zwar auch remote, in Präsenz aber „schneller, klarer und kräfteschonender“ gehe, kommentiert Christian Bölling, Gründer und CEO der Münchner Agentur Heldenmood auf LinkedIn mit den Worten: „Kräfteschonender ist Daueranwesenheit nur für den (Gendern in diesem Fall nicht erforderlich), der sich das leisten kann, weil sich daheim jemand anderes um ausfallende Kitas und so weiter kümmert.” Und der habe es dann „auch einfach, weil er seine Schäfchen vermeintlich im Blick hat und weiter diejenigen befördert, die am längsten am Schreibtisch abspacken und auch noch das Feierabendbier mitnehmen.“
Kleine Info von mir am Rande: Dass Gendern laut Bölling im Falle der Agentur Antoni nicht erforderlich ist, liegt vermutlich daran, dass die siebenköpfige Führungscrew der Berliner Agentur tatsächlich ausschließlich aus Männern besteht. Willkommen im Jahr 2024.
Aber zurück zum Thema. Bölling begründet seine Vermutung, dass nur jene befördert würden, „die am längsten am Schreibtisch abspacken“ mit dem Verweis auf eine Analyse, über die das Wall Street Journal Mitte Januar berichtete. Danach hat der US-amerikanische Datenanalyst Live Data Technologies die Jobentwicklung von zwei Millionen White-Collar-Angestellten im letzten Jahr untersucht. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, befördert zu werden, lag für 100 Prozent remote Arbeitende 31 Prozent niedriger als für ihre hybrid oder zu 100 Prozent in Präsenz arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt wurden von den ausschließlich remote Arbeitenden laut Analyse 3,9 Prozent befördert, von den hybrid oder voll in Präsenz Arbeitenden 5,6 Prozent. Böllings Konklusion: „Vielleicht braucht die moderne Arbeitswelt neue Führungskräfte statt alter Regeln.“
Lernphase noch nicht vorbei
Liegt es also „nur“ am Führungspersonal? Eins ist klar: In Zeiten des Wandels von Arbeitgeber- zu Arbeitnehmermärkten liegt der Ball zur Lösung des Homeoffice-Konflikts eindeutig im Feld von Geschäftsführung und HR. Claudia Diaz etwa, Geschäftsführerin Ressourcenmangel, die ich zu Antonis Vorstoß vor ein paar Tagen befragt habe, bemüht sich bei ihrer Einschätzung um größtmögliche Ausgewogenheit. Sie könne zwar „den Impuls verstehen“, sich nah zu sein und persönlich zu begegnen. „Vor allem im Fall noch junger Talente ist es durchaus sinnvoll, sich öfters live zu sehen. Der direkte Draht zu erfahrenen Kolleg*innen ist wichtig“, sagt Diaz. Die Pandemie habe aber auch gezeigt, dass vieles dezentral gut funktioniere. Mehr Freiheit und Selbstorganisation würden jedoch mehr Verantwortung mit sich bringen und zu klarerer Kommunikation und allseitiger Transparenz verpflichten. „Aktuell befinden wir uns alle noch in einer Lernphase“, so Diaz. Wir brauchen Zeit, bis sich neue Wege, Standards und Formate etabliert und wir die hybride Welt perfektioniert haben“. Manchmal müsse man dafür neue Regeln aufstellen, manchmal alte abschaffen.
Apropos: Auch bei Antoni ist Regel nicht gleich Regel. Auf meine Nachfrage präzisiert Pressefrau Jessica Fuchs: „Für alleinerziehende Mütter und Väter oder bei Mitarbeitenden, die ihre Eltern pflegen, gilt weiterhin die alte Antoni-Regelung 50/50. Auch nicht alleinerziehende Eltern können ihre Kinder selbstverständlich morgens in die Kita beziehungsweise Schule bringen, sie nachmittags abholen und von zu Hause weiter remote arbeiten.“ Für Teilzeitbeschäftigte, die rund 11 Prozent der Antoni-Belegschaft ausmachen, gelte ab sofort eine 3+1-Regelung. Also vier Tage Präsenzpflicht und ein Tag Homeoffice.
New Work hat keine Zukunft – Zwinkersmiley
Irgendwie passt dazu auch eine aktuelle Studie des Bitkom. Von 604 befragten Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland glauben 86 Prozent, dass sie ihre Arbeitskultur modernisieren müssten. Eine stattliche Zahl anno 2024. Aber was sag‘ ich? Immerhin 75 Prozent meinen, dass Unternehmen, die sich dem Thema New Work verschließen, im Wettbewerb nicht mehr bestehen werden. Allerdings sehen sich nur 17 Prozent bei New Work an der Spitze, 46 Prozent verorten sich zumindest unter den Vorreitern.
Aber: 17 Prozent sagen, für „so einen Firlefanz wie New Work“ kein Geld zu haben, weitere 13 Prozent halten das Thema nur für einen Hype, der bald wieder vorüber ist. Macht unterm Strich 30 Prozent, die New Work langfristig als wenig bis gar nicht relevant erachten.
An Stellen wie dieser erinnere ich mich selbst immer wieder mit größter Freude an eine Studie des Zukunftsforschers Matthias Horx, der im März 2001 feststellte: „Das Internet wird kein Massenmedium“. Das ist jetzt läppische 23 Jahre her, und es kam bekanntlich anders. Vielleicht sollten wir New Work also einfach noch ein bisschen Zeit geben. Zwinkersmiley.
Abends an die Bar
Und bis dahin staunen wir noch voller Freude über Leute, die schon jetzt in Richtung Zukunft denken. So wie Björn Gieß und Patrick Runge, Gründer von Tapdesk. Das Start-up will in Bars und Restaurants außerhalb ihrer regulären Öffnungszeiten Coworking Spaces anbieten. „Tapdesk fungiert als Plattform, ähnlich wie Airbnb für Coworking“, erklärt Gieß gegenüber t3n. Er und sein Mitgründer Patrick Runge wollen die Bars und Restaurants allerdings nicht selbst anmieten, wohl aber mit technischer Infrastruktur wie Smart Locks und Videosystemen ausstatten. Der generierte Umsatz soll zwischen Gastronominnen und Gastronomen sowie Tapdesk aufgeteilt werden.
Eine echte Win-Win-Win-Situation also: Gastronomie und Start-up verdienen Geld – und Coworker können zum Feierabend Drink einfach sitzen bleiben.
In diesem Sinne: Eine ideenreiche Woche – und bleiben Sie gut drauf!